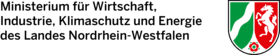An der RWTH Aachen arbeiten Forscherinnen und Forscher an einem voll implantierbaren Kunstherz, das die Wartezeit auf ein Spenderorgan überbrückt. Das Start-up ReinHeart aus Aachen entwickelt das Kunstherz für den klinischen Einsatz weiter.
Mehr als 10.000 Menschen warten in Deutschland auf ein Spenderorgan. Die Wartezeit erstreckt sich für Betroffene häufig über Jahre – und endet teilweise erfolglos. Wenn Organe gespendet und transplantiert werden, dann sind das häufig Niere oder Leber, schon an dritter Stelle liegt das Herz: Laut Eurotransplant wurden in der Bundesrepublik 2019 insgesamt 324 Herzen gespendet und transplantiert. 706 Personen stehen aber weiterhin auf der Warteliste für ein lebensrettendes Organ. Und für genau diese Menschen arbeitet die ReinHeart TAH GmbH gemeinsam mit Forscherinnen und Forschern der RWTH Aachen an einem voll implantierbaren Kunstherz, das die Wartezeit auf ein Spenderorgan überbrückt.
„Wir entwickeln in Aachen mit dem ReinHeart das erste Kunstherz, das mindestens fünf Jahre lang voll implantiert im Körper der Patienten verbleiben kann“
Dr. Thomas Finocchiaro, wissenschaftlicher Leiter der ReinHeart TAH GmbH

Dieses voll implantierbare Kunstherz könnte den herrschenden Mangel an Spenderherzen reduzieren, bis heute ist es aber nicht im klinischen Einsatz. Um die neue Antriebstechnik für das Aachener Kunstherz nun auch in die Kliniken zu bringen, hat PROvendis im Mai 2019 im Auftrag der RWTH Aachen einen Kaufvertrag mit der ReinHeart TAH GmbH zum erfolgreichen Abschluss gebracht. Das Start-up ReinHeart hat sich auf Kunstherzsysteme spezialisiert und entwickelt die Aachener Erfindung stetig weiter.
Erfunden wurde die wertvolle Alternative zur Herztransplantation von einem Team aus Aachen, eine ganze Reihe von Spezialisten hat an der Entwicklung mitgewirkt: Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Lehr- und Forschungsgebietes Kardiovaskuläre Technik des Instituts für Angewandte Medizintechnik (AME) am Helmholtz-Institut für Biomedizinische Technik der RWTH Aachen und des Universitätsklinikums Aachen, des Herz- und Diabeteszentrum NRW (HDZ) und des RWTH Instituts für Elektrische Maschinen (IEM) setzten ihr Know-how für die Entwicklung des Kunstherzens ein.